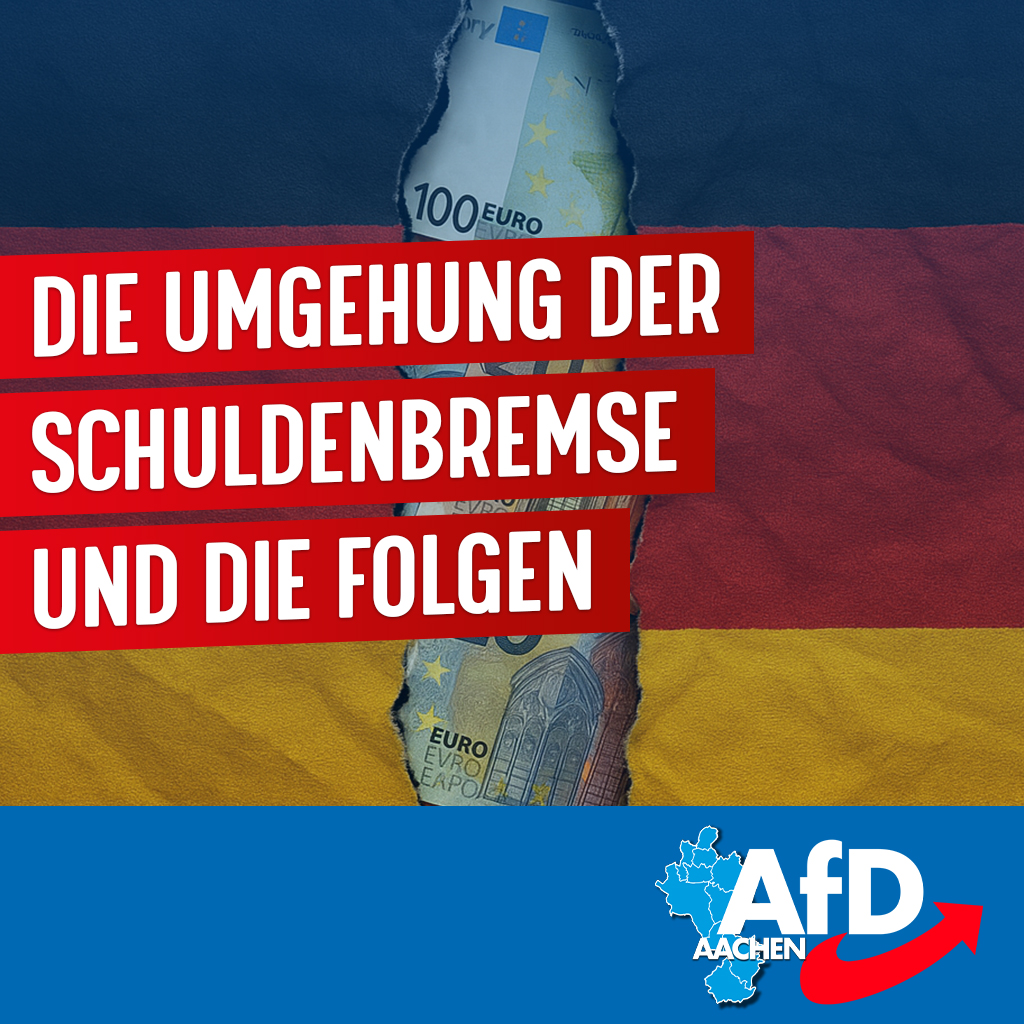Die offiziell veröffentlichen Zahlen über die Verschuldung von Bund, Ländern und Gemein-den beruhigen nur vermeintlich und auf den ersten Blick. Sie betragen grob „nur“ 63 % des Bruttoinlandsprodukts. Sie betrugen 2.689 Mrd. Euro im Jahr 2024.
Ist die Höhe der tatsächlichen Schulden transparent?
Doch hinzu kommen zahlreiche „Sondervermögen“, die bei genauer Betrachtung ganz über-wiegend Sonderschulden sind, die quasi aus dem Bundeshaushalt ausgelagert wurden und deren Valuten sich der öffentlichen Transparenz entziehen. Der finanzielle Umfang beläuft sich laut einem Bericht des Bundesrechnungshofs aus dem Jahr 2023 auf grob 870 Mrd. Eu-ro. Die Schuldenbremse wird so umgangen. Rückzahlungen können zudem weit in die Zu-kunft verlagert werden.
Wie hoch sind die tatsächlichen Schulden?
Die nun aktuell von der abgewählten Bundesregierung mit der CDU gemeinsam beschlosse-nen neuen „Sondervermögen“ von 900 Mrd. Euro werden langfristig, da nicht vollumfänglich sofort eingesetzt, den tatsächlichen Verschuldungsumfang sukzessiv massiv erhöhen. Es ist daher zu erwarten, dass sich unter Berücksichtigung der bisherigen Sonderschulden der tat-sächliche Gesamtverschuldungsumfang in Richtung 100 % des Bruttoinlandsproduktes ent-wickeln wird.
Was sind die Konsequenzen?
Der Staat beschafft sich die Mittel, indem er Staatsanleihen mit entsprechender Rendite für Anleger am Markt anbietet. Dieser Zinsaufwand belastet aber den Staatshaushalt zukünftig erheblich.
Deutschland hat zurzeit eine hohe Kreditwürdigkeit, eine sogenannte Triple A (AAA-Bewertung – höchste Bonitätsstufe). EU-Staaten mit über 100 % Staatsverschuldung haben eine derartige Bewertung allerdings nicht. Es besteht also die Gefahr, die derzeitige Boni-tätsbewertung zu verlieren. Die Folge wäre, dass sich die Zinsbelastung für den Staat dadurch nochmals erhöhen würde. Auch die Wirtschaft könnte durch ansteigende Zinsen dann belastet werden.
Eine Ausweitung der Verschuldung in einem derartigen Ausmaß produziert also Risiken für die Zukunft.
Sind „Sondervermögen“ für Kommunen die Lösung?
Städte und Gemeinden hoffen nun auch auf das sogenannte „Sondervermögen“, wobei vor-gesehen ist, dass 100 Mrd. Euro den Kommunen direkt zu Gute kommen sollen. Was effektiv bei den Kommunen davon ankommt, bleibt allerdings abzuwarten. Die Investitionsrückstän-de der Kommunen, z.B. für Schulen, Straßen, Sportstätten usw. belaufen sich bundesweit bereits bis 2023 auf deutlich über 180 Mrd. Euro. Allein in NRW betragen sie schon über 50 Mrd. Euro. Diese negative Entwicklung hat in den letzten 5 Jahren stetig zugenommen und dürfte sich weiter fortentwickeln.
Aufgrund einer Vielzahl an Hemmnissen, wie unpassende Förderungen, zu geringe Anteile am Steueraufkommen der Kommunen oder komplizierte bürokratische Vorgaben, vor allem steigende Sozialausgaben, blicken viele Kommunen pessimistisch in die Zukunft und be-fürchten gar eine weitere Erhöhung des Investitionsstaus. Die geplanten Sonderschulden, die für Kommunen vorgesehen sind, dürften also kaum ausreichen.
Die Substanzerhaltung auf der kommunalen Ebene bleibt also ein Problem, da schließlich auch weitere Abnutzungen der Infrastruktur von Jahr zu Jahr eintreten. Hohe Schuldenpake-te des Bundes sind daher abzulehnen, da sie die strukturellen Probleme der Kommunen dauerhaft nicht lösen können und vorrangig zur Instabilität der Staatsfinanzen beitragen.